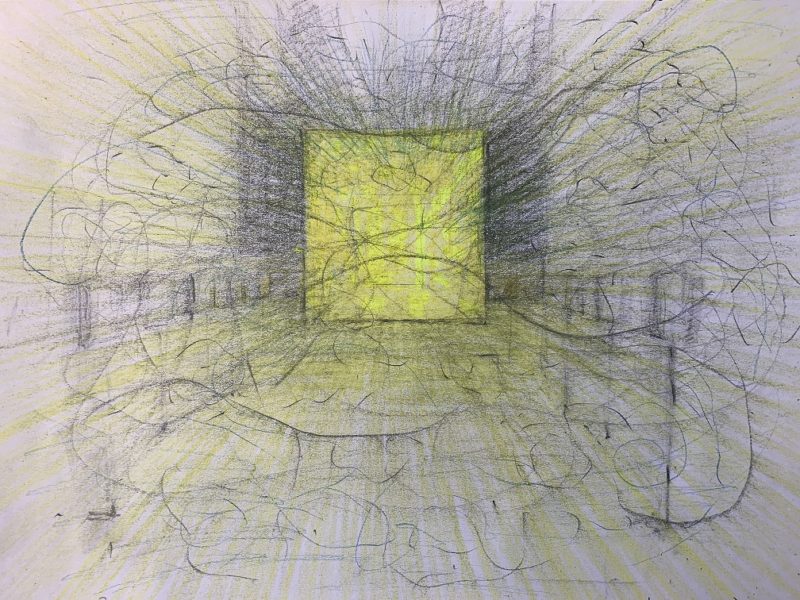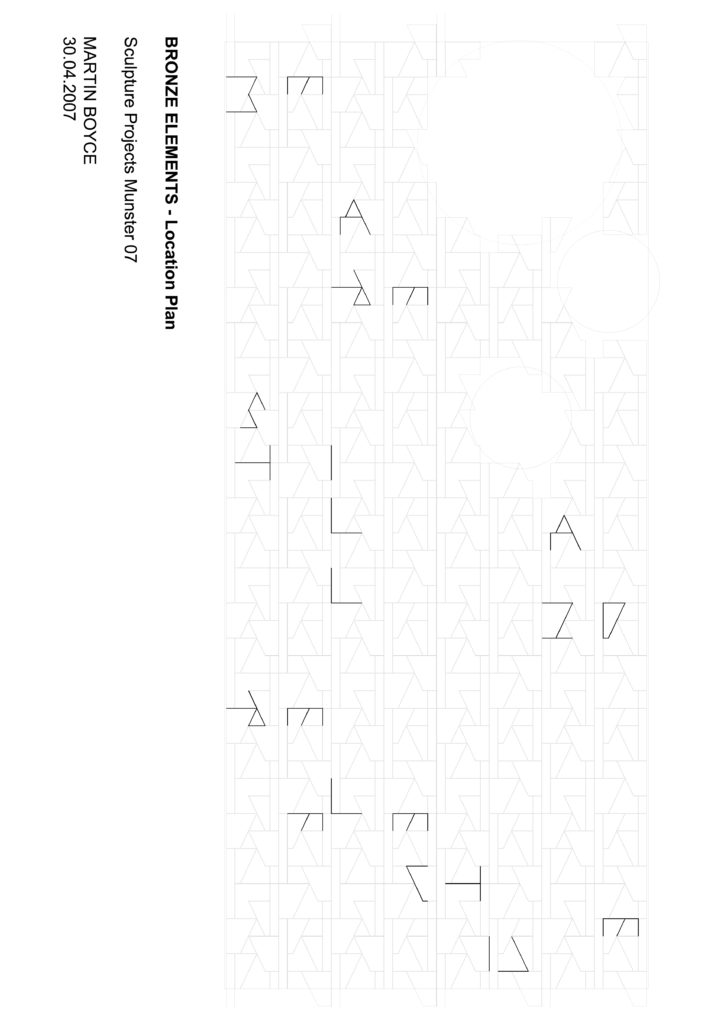Das Projekt einer Bildtheologie ist von seiner gesamten Struktur her dem theologischen Topos des Bilderverbotes ausgesetzt. Die Spannung zwischen der Transzendenz göttlicher Wirklichkeit, der aus dieser resultierenden Unmöglichkeit figurativer Darstellung Gottes und dem gleichzeitigen Bedürfnis des Menschen, durch visuelle Repräsentation das Gefühl einer Gegenwärtigkeit Gottes zu unterstützen, hat in vielen Kulturkontexten zu einer dynamischen Bewegung zwischen Bilderverboten, neuen Bildkulten und anikonischen Darstellungsweisen geführt. Speziell letztere besitzen einen ästhetischen Charakter, der in weiten Teilen von der theologischen Forschung wenig behandelt wurde. Dieser Artikel versucht einen Beitrag zur Frage nach der Sinnhaftigkeit und der bildtheoretisch ästhetischen Hermeneutik anikonischer Darstellung zu leisten. Dabei soll versucht werden, die anikonischen Darstellungsweisen des Bundesgottes JHWH zunächst mit ihren Spiegelungen im Neuen Testament, daraufhin aber auch mit der im westlichen Diskurs oftmals unbekannten anikonischen Darstellungsweise des Buddha ins Gespräch zu bringen. Dabei soll nicht aufs Neue die theologische Relevanz und Struktur des alttestamentlichen Bilderverbotes detailliert ausgearbeitet werden. Es geht zu Anfang lediglich darum, (I.) einige Strukturmomente und Begründungsversuche anikonischer Darstellungsform im hebräischen Kulturraum aufzugreifen, um anschließend (II.) mit Berücksichtigung einer spezifischen ästhetischen Anschauung ihre neutestamentliche Reflexion aufzuführen. Hieraus werden dann (III.) einige ästhetische Fragestellungen theologisch aufgegriffen und Überhangprobleme formuliert, die sich vor allem aus dem Spannungsfeld von ikonischer und anikonischer Darstellung ergeben. Diese werden daraufhin (IV.) durch die anikonische Darstellung des Buddha im frühen Buddhismus und ihre spezifische buddhologische Bedeutung von einer Außenperspektive betrachtet, aus der dann (V.) im Rückbezug spezifische ästhetische Sichtweisen anikonischer Darstellungen diskutiert werden können.
Das Ziel dieses Beitrags ist es also, durch den Einbezug der buddhistischen Perspektive einen neuen Blick auf die Spannungsmomente zu gewinnen, die sich bei einer genauen Analyse des bildtheologischen Anliegens im Zusammenhang mit dem Bildervorbot und der anikonischen Darstellung ergeben.
Die Perspektive des Autors ist dabei die eines katholischen Theologen, dessen Forschungsfeld in der Fundamentaltheologie und der Komparativen Theologie angesiedelt ist. Es wird und kann nicht mein Ziel sein, neue buddhologische Erkenntnisse zu generieren. Meine Ausführungen beziehen sich im buddhistischen Teil auf den aktuellen Stand der kulturwissenschaftlichen Forschung. Meine Gedanken haben sich jedoch ebenfalls in einem langjährigen Austausch mit verschiedenen buddhistischen Traditionen und auf ausgiebigen Forschungsreisen entwickelt. Meine Arbeitsweise folgt der gängigen Methode Komparativer Theologie, wie sie vor allem von James Fredericks und Francis Clooney entwickelt und von Klaus von Stosch in den Europäischen Kontext weitergeführt wurde.
I. Grundmuster des alttestamentlichen Bilderverbotes
Historisch betrachtet war es nicht etwa die hebräische Kultur, aus der sich das Bilderverbot entwickelt hat, sondern es war der ägyptische Pharao Echnaton, der den ältesten bisher bekannten Bildersturm in seinem eigenen Reich veranlasste. Dieser hatte jedoch keinen tatsächlich anhaltenden Ikonoklasmus der ägyptischen Religiosität zur Folge. Die Ägypter blieben ihren Göttern und den bildhaften Darstellungen treu. Die Abgrenzung, die Echnaton ca. 1350 vor Christus vollzog, war jedoch, genau wie diejenige der israelisch hebräischen Kultur ca. 600 Jahre später, eine Abgrenzung nach Innen und Außen. Sie wendet sich gegen einen Götterkult, der integrativ zur Verehrung zahlreicher Gottheiten neigt, die in ihren jeweiligen Qualitäten jeweils verschieden figurativ abgebildet wurden, hin zur Verehrung eines Gottes, der in seiner Einmaligkeit alle Darstellungen übersteigt, wie sich dies unmissverständlich im Sonnengesang des Echnaton ausdrückt. Waren es vor Echnaton noch einzelne Gestalten, wie die Göttin Maat, der Gott Seth und zahlreiche andere personifizierte und hypostasierte Aspekte, die den Sonnenzyklus in seiner Wandlung und Dynamik hervorriefen, so stellt sich im Sonnengesang zum ersten Mal die Anbetung eines einheitlichen Gottes dar, der nicht mehr durch figurative Darstellungen repräsentiert wird, sondern alleine als Licht der Sonne sich auf der Erde offenbart. Dieser für seine Zeit radikale Umsturz der religiösen Ordnung hatte zur Folge, dass nahezu alle Tempel geschlossen und die figurative Darstellung von Gottheiten untersagt wurde. Die Radikalität Echnatons führte jedoch auch zum Niedergang seiner Angestrebten Reform. Der Götterkult kehrt nach Ägypten zurück und die Tempel wurden wieder geöffnet.
Obwohl sich die Reform Echnatons in Ägypten nicht durchsetzte, hielt der Einfluss ihres Grundgedankens an und übertrug sich in den hebräischen Kulturraum, wie sich vor allem im Psalm 104 zeigt, der die Gedanken des Sonnengesangs Echnatons weitreichend aufnimmt. Im Psalm 104 zeigt sich außerdem der direkte Zusammenhang des monotheistischen Gedankens und dem Bilderverbot. Weil Gott nun nicht mehr ein einzelner Aspekt ist, sondern in seinem Wesen die Ursache von allem, kann er auch nicht mehr als einzelner Aspekt dargestellt werden. Weiter ergibt sich eine Logik der Durchsetzung des monotheistischen Gedankens: Der Übergang von der Verehrung vieler Götter zur Verehrung eines Gottes braucht als ersten Schritt die Negierung aller bildlichen Darstellungen unterschiedlicher Götter, weil diese die polytheistische Idee in einer Form von visueller Selbstevidenz aufrecht erhalten. Sind die jeweiligen figurativen und bildlichen Darstellungen verdrängt, können sprachlich lexikalische Differenzen viel leichter moderiert und inklusiv verarbeitet werden.
So ging auch die hebräische Entwicklung zum Monotheismus mit einem Bilderverbot einher. Die zentrale Erzählung, um die sich das biblisch hebräische Bilderverbot aufbaut, ist die Sinai-Perikope. In ihr zeigen sich zunächst zwei deutliche Parallelen zur ägyptischen Götterbildverehrung und dem Versuch der Überwindung: Das Bilderverbot richtet sich zunächst nach innen und dient nicht einer Abgrenzung zu anderen Volksstämmen, die im Gegensatz zur eigenen Tradition Bilder verehren. So berichtet die Erzählung, dass Mose für 40 Tage auf dem Berg Sinai verschwand und das Volk nicht mehr mit seiner Wiederkunft rechnete. Aus dem Reflex der Herstellung eines Götzenbildes, wie ihn die Perikope berichtet, lässt sich auf die ursprünglich polytheistische Praxis von Gottesbildverehrungen in der hebräischen Bevölkerung selbst schließen.
Der Umstand, dass die Statue eines goldenen Kalbes hergestellt wurde, weil Mose als ursprünglicher Mittler zum Bundesgott JHWH fernbleibt, lässt Rückschlüsse auf eine zweite analoge Struktur zu: Die Gottesbilder wurden aufgestellt, um die Gegenwart göttlicher Kräfte zu vermitteln und aufrecht zu erhalten. Da Mose als Mittler fernblieb, wurde versucht, das Vakuum durch ein Götzenbild zu ersetzen.
Die gesamte Darstellung weist jedoch darauf hin, dass es im Verbot von Bildnissen nicht darum geht, „das prinzipielle Unvermögen von Bildern, Gottesnähe zu gewährleisten“ herauszustellen, sondern genau um das Gegenteil. Das Bilderverbot erkannte die Macht des Bildes, zumindest für den Menschen eine Präsenz Gottes gefühlsmäßig erfahrbar zu machen. Aus diesem Vermögen von Bildern und allgemeinen Bildnissen folgte jedoch ein immer stärker wachsendes Spannungsvermögen zum Transzendenzgedanken des Bundesgottes JHWH, der sich nun nicht mehr reduzieren ließ auf ein konkretes Bildnis, weil er jede Form überstieg. Als das, was jede Form übersteigt, widersetzt sich der Transzendenz betonende Gottesgedanke des Volkes Israel dem auch in ihm anwesenden Bedürfnis, die Gegenwart Gottes in Bildnissen ansichtig zu machen.
Historisch entwickelte sich das Bildverbot im hebräischen Kulturraum grob gezeichnet in drei Schritten: Zunächst waren nomadische und halbnomadische Kulturkreise im Mittelmeerraum oft von einem anikonischen Kultus geprägt. Zwar findet sich selten eine geforderte Bildlosigkeit, doch kann damit gerechnet werden, dass sich in diesen nomadischen Kontexten eine Form von Präsenztheologie entwickelt hat, die sich über verschiedene Stufen zu anikonischen Darstellungen im Kultus, wie der des Ladenkultes und des freien Raumes zwischen den Flügeln der Seraphim im Tempel entwickelt hat.
Die Formen anikonischer Darstellungen boten einen Raum, in dem sich die Verbreitung der Monolatrie, zunächst inklusiv, dann ausschließend, leicht vollziehen konnte, da sich ohne ein konkretes Bild die vielleicht konzeptionell vorhandenen Differenzen leichter überwinden ließen, weil sie sich nicht visuell evident ausdrückten. So bildet die anikonische Darstellungsweise auch eine gute Übergangsfunktion von der Monolatrie zum Monotheismus, der sich in etwa zwischen 800 und 700 v. Chr. ansetzen lässt. Die Verstärkung der beiden Momente der bildlosen Verehrung und des sich immer stärker durchsetzenden Monotheismus bedingen sich dabei wahrscheinlich gegenseitig, da beide Anschauungsweisen kompatibel sind.
Aus dieser Bedingtheit scheint eine Dynamik erwachsen zu sein, die zu einer immer stärker zunehmenden Polemik gegen Bilderverehrung im religiösen Kult geführt hat, der in der biblischen Überlieferung in der Person Hoseas kumuliert. Dieser führt die Verwerfung des Volkes durch JHWH primär auf die Verletzung des ersten Gebotes zurück (vgl. Hos 4,3), welches unmittelbar mit dem zweiten Gebot zusammenhängt und somit bei Hosea auch zu einer sehr frühen expliziten Bildkritik führt.
Betrachtet man die dargestellte Spannung zwischen dem Verbot von Bildern und Bildnissen im Kult einerseits und dem Bedürfnis der Darstellung göttlicher Präsenz andererseits, gelangt man zum Modell der anikonischen Darstellung als Kompromiss, wie er sich dann im Zuge der JHWH-Alleinverehrung auch durchgesetzt hat. Die anikonische Darstellung präsentiert kein konkretes Bild mehr, das den Bundesgott selbst in einer Form von Einschränkung präsentieren würde, sondern einen Raum, der eine Form von Umrahmung aufweist, in welcher die Präsenz JHWHs im leeren Raum angezeigt ist. Diese setzt sich bereits unter König Salomo durch, der im Tempel die anikonische Darstellung im eingefassten Raum von vier Cheruben-Flügeln für den Tempelkult adaptierte. Was sich hier zeigt, ist theologisch bemerkenswert, und es ist, bei aller Vorsicht, Keel recht zu geben, der diese Darstellung tatsächlich dem apophatisch geheimnishaften Charakter der hebräischen Gottesvorstellung zuschreibt. Diese übernimmt die Heiligkeit des leeren Raumes zwischen zwei Cheruben auf der Bundeslade aus dem ägyptisch-sumerischen Kulturraum, wo er parallel als leerer Raum zwischen zwei Sphinxen eine analoge Funktion erfüllt. Die beiden Cheruben im salomonischen Thron schützen mit ihren Flügeln nicht etwa das Heilige, sondern sie tragen es. Diese Einsicht führt direkt zurück auf die Darstellung der Bundeslade, die ebenfalls eine Tragevorrichtung darstellt, auf der der Bundesgott JHWH vor dem Volk getragen wurde. In dieser Funktion kommt etwas Typisches für die anikonische Darstellung zum Vorschein: Durch Handlungen oder Rahmungen wird eine Präsenz verdeutlicht, die jedoch nicht physisch bildhaft fixiert wird. Im Fall der Lade ist es das Tragen JHWHs und der Rahmen der beiden Cheruben. Das, was getragen wird, ist als das Nicht-Darstellbare, weil über alles Darstellbare Hinausweisende, dargestellt und somit in seiner umfassenden Geheimnishaftigkeit dem Betrachter vor Augen geführt. Etwas, das Sichtbar ist, macht das sichtbar, was nicht sichtbar ist.
II. Spiegelung des Gedankens im neuen Testament
Um die Spiegelung des alttestamentlichen Bilderverbotes und der anikonischen Darstellung im Neuen Testament aufzugreifen, eignet sich besonders die Areopagrede des Paulus (Apg 17,16–34). Diese beginnt zunächst damit, dass es Paulus den Atem nimmt (παρωξύνετο), als er bei einem Stadtrundgang durch Athen die Stadt mit Idolen (κατείδωλον) vollgestellt vorfindet. In der Konfrontation mit lokalen Intellektuellen versucht Paulus jedoch zunächst diplomatisch aufzuzeigen, dass die Griechen von der Grundstruktur denselben Glauben verfolgen, wie den, den er verkündet. Dafür verweist er auf eine Altarsüberschrift, die da lautet: „Einem Unbekannten Gott“ (Ἀγνώστῳ θεῷ). Dieser Unbekannte Gott sei genau der Gott seines Bekenntnisses, so Paulus zu den philosophisch wahrscheinlich ausgebildeten Intellektuellen in Athen. Dieser Gott sei unbekannt, weil er die Größe bildet, in der wir als Menschen leben, uns bewegen und in der wir sind (ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν). Doch gerade aus diesem Grund, so Paulus, geht es gänzlich fehl, diese Größe auf Götzenbilder zu reduzieren. Paulus sagt aber noch mehr. Weil wir uns in Gott bewegen, dürfen wir nicht meinen, dass es recht sei, ihn als menschengemachtes Gebilde zu verehren. Der hier von Paulus angeführten Gottebenbildlichkeit des Menschen liegt also gerade der Fehlschluss zugrunde, dem die Griechen in Athen mit den Bildnissen verfallen sind. Doch warum? Liegt hier nicht eine Steilvorlage? Gerade weil der Mensch von Gottes Art ist, ist es da nicht gerade recht, dass er seine Schöpferkraft nutzt, um Bildnisse zu schaffen, die zur Verehrung dienlich sind? Und müssen diese nicht gerade dem Menschen ähnlich sein, wenn dieser nach dem Bild Gottes geschaffen wurde?
Der Gedanke der anikonischen Darstellung des Bundesgottes JHWH wird hier in gewisser Weise gespiegelt. Der leere Altar übernimmt die Funktion der Rahmung, die im hebräischen Kontext die Cheruben übernommen haben. Die Überschrift „Dem unbekannten Gotte“ weist ebenfalls darauf hin, dass auf dem Altar eine Anwesenheit präsent ist, die alles Darstellbare transzendiert und somit nur als das Undarstellbare dargestellt werden kann. Die Ausführungen Pauli weisen ebenfalls auf die Logik: Das, worin wir sind, kann nicht reduziert werden auf etwas dinglich Eingeschränktes, weil es allem dinglich Eingeschränkten vorausliegt.
Thomas von Aquin nimmt in seinem Römerbriefkommentar die Areopagrede auf und macht das Argument des Paulus nochmals zugänglicher. Das, was Gott ist, ist dem Menschen unbekannt. Alles, was dem Menschen bekannt ist, basiert auf der Basis ihm konaturaler Sinneseindrücke und deren Verarbeitung. Das menschliche Wesen ist aber gerade nicht dazu proportioniert, das Sein Gottes selbst zu fassen.
Doch das Neue Testament fügt dem Bildgedanken eine neue Dimension hinzu, die deutlich wird, wenn man die paulinische Aufnahme des Bilderverbotes in Kol 1,15–20 einbezieht. Das Motiv der Areopagrede wiederholt sich hier dahingehend, dass Gott weiter der Unsichtbare bleibt. Er wird aber gerade in Christus als Bild des Unsichtbaren Gottes (εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου) als Unsichtbarer sichtbar. Die Argumentation ist recht analog. Die kosmische Struktur der Areopagrede wird hier auf die Person Christi übertragen, in der alles erschaffen wurde (ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα), das Sichtbare und das Unsichtbare (τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα). Die Darstellung ist hier komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Die Adressaten des Briefes waren die Ansicht von Bildern gewöhnt, vor allem aus dem bekannten Götter- und Kaiserkult. Auch die Götter stellten als Bild etwas dar, was eigentlich unsichtbar ist. Dennoch taten sie dies in anderer Form und mit einer anderen Begründung.
Die Auslegung von Kol 1,15 hat eine lange Geschichte, die sich um einen ausgedehnten Schulstreit bildet, welcher die Frage behandelt, ob Christus das Bild Gottes als präexistenter Logos ist, oder in seiner weltlich-menschlichen Erscheinungsform. Die Frage ist jedoch nicht allzu schwer zu beantworten: Christus macht als Mensch den unsichtbaren Gott sichtbar. Seine göttliche Natur ist dabei ebenso unsichtbar, wie die göttliche Natur des Vaters, um diese sichtbar zu machen, braucht es jedoch die menschlich-weltliche Form. Christus macht also in seiner menschlichen Natur die unsichtbare Natur des Vaters und damit auch seines eigenen Wesens sichtbar. Die Frage bildet sich nochmals in einer größeren Spannung ab, wenn der Vers 17 einbezogen wird. Denn in seiner körperlichen Form kann Christus eben nicht vor allem (πρὸ πάντων) gewesen sein, wenn das vor temporal verstanden wird.
Bezieht man die Intention des Briefes ein, sich gegen die kollosäische Häresie zu wenden, die Christus nach dem Fleische als minderwertig betrachtete, so zielt die Argumentation in der Einbindung des Hymnus darauf ab, Christus als leibhaftiges Bild der uneinholbaren göttlichen Wirklichkeit anzusetzen, denn in ihn wohnt „die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig“ (Kol 2,9) (πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς). Das heißt Christus ist als Mensch, in seiner konkreten Gestalt Ausdruck, sinnliches Bild des unsichtbaren Gottes. In ihm zeigt sich die Unsichtbarkeit dessen, der alles ist und alles erschaffen hat. Sie zeigt sich aber als Geschöpf. In dieser Weise wird die Gottebenbildlichkeit des Menschen auf eine andere Ebene gehoben. Die Geheimnishaftigkeit, die der anikonischen Darstellung Gottes zugrunde liegt, ist somit in Christus als Menschen präsent. Die Funktion, die der Altar und auch die Cheruben erfüllten, wird nun durch einen konkreten Menschen erfüllt. Ein Mensch wird der Raum, in dem sich das absolut Undarstellbare darstellt. Versteht man Christus hier als Urbild eines jeden Menschen, so wird die Struktur, die sich in Christus darstellt, auf jeden Menschen übertragen. Der Mensch wird der Geheimnishaftigkeit Gottes teilhaftig.
Obwohl der Kolosserbrief wahrscheinlich nicht von Paulus stammt, ergibt sich für den Gesamtkorpus des Neuen Testamentes im Zusammenhang mit dem aus dem Alten Testament übernommenen Bilderverbot eine enorme Spannung. So gilt die Anbetung von Statuen immer noch als verboten (Areopagrede), dennoch hat sich der unbekannte, unsichtbare Gott selbst eine Gestalt gegeben. Christus ist die sichtbare Gestalt des unsichtbaren Gottes. Das heißt Gott selbst gibt seiner Unsichtbarkeit einen sichtbaren Ausdruck. Das heißt jedoch schon, dass es bei der Gestalt Christi nicht allein um die Aufnahme des sensual sichtbaren Gehaltes gehen kann, sondern darum, gerade in diesem die Unsichtbarkeit Gottes zu sehen. Im Johannesevangelium drückt sich dieser Zusammenhang durch die Worte Jesu selbst aus: „Wer mich sieht, sieht den Vater.“ (Joh 14,9) Doch um welche Art des Sehens geht es hier? Würde die Person Jesu auf die historische Erscheinung reduziert, hieße das, dass man beim Sehen Jesu nicht sieht, was sich zu sehen gibt. Nur wer in Christus den Vater sieht, sieht richtig.
Die dargestellte Spannung führte zum innerchristlichen Bilderstreit, der sich historisch vielfach wiederholte. Das Zweite Konzil von Nicäa folgte jedoch der Argumentation, die sich im Kolosserbrief ausfaltet: Weil Gott sich selbst in Christus einen sichtbaren Ausdruck gegeben hat, ist es möglich, Bildnisse von ihm und auch von seiner Mutter und den Heiligen zu verehren (προσκύνησις), jedoch nicht, sie anzubeten (λατρεία). Der Unterschied ist bereits an dieser Stelle ein ästhetischer: Wie bei Christus macht die Ikone etwas Unsichtbares sichtbar. Sie, die Ikone, in ihrer materialen Gegebenheit anzubeten hieße, genau diesen Modus misszuverstehen.
III. Ästhetische Grundspannung
Johann Georg Hamann entwarf im Zuge seiner Metakritik zur Aufklärung einen für die aktuelle wissenschaftliche Debatte der Ästhetik recht eigentümlichen Gedanken: „Die älteste Ästhetik liegt darin, Gott über alle Dinge zu fürchten und zu lieben und ihm allein zu vertrauen.“ Hamann wendet sich mit diesem Zitat gegen eine in der Aufklärung entstandene Wissenschaftsrichtung der Ästhetik, welche diese auf die reine Verarbeitung von Sinnesdaten reduziert, die dann lediglich geordnet und subjektiv bewertet werden. Neben Baumgarten wurde diese Ansicht vor allem mit weitreichenden Einfluss von Kant geprägt und durchdringt den wissenschaftlichen Gebrauch des Begriffs der Ästhetik bis heute. So geht es Kant im Anschluss an Baumgarten in der ästhetischen Anschauung um ein strikt subjektives Geschmacksurteil. Was sich zeigt, ist dass das, worauf diese Anschauung zielt, lediglich der sensuale Gehalt ist. Aber das Wort aisthesis (αἴσθησις) zielt schon von seinem etymologischen Ursprung her nicht einfach auf den Eingang sensualer Daten und deren Verarbeitung, sondern auf das Verstehen dieser Daten. Der Akt der aisthesis geschieht somit im Sinne des Sehens nicht einfach dadurch, etwas zu sehen, sondern das, was sich als das zu Sehende gibt, auch als das zu verstehen, was es ist. Als ein gutes Beispiel kann hier ein Deutsch sprechender Mensch auf einem chinesischen Bahnhof angeführt werden. Wenn diesem nun auf Chinesisch gesagt wird, dass heute keine Züge mehr fahren und er somit vergeblich wartet, dann ist er nicht in der Lage, den Inhalt der Aussage zu verstehen, was nicht bedeutet, dass er diese nicht hört. Ihm fehlt lediglich die richtige aisthesis, die für das Verständnis jedoch zwingend notwendig ist. Übertragen auf die Person Christi fehlt jenem die richtige Ästhetik, der in der weltlichen Gestalt Jesu nicht die Unsichtbarkeit des alles umfassenden Gottes erkennt. Denn sieht man die beiden angeführten Quellen der Areopagrede und Kol 1,15 zusammen, dann ist die Person Jesu als Mensch das Bild der allumfassenden Wirklichkeit, in der wir sind und in der wir leben. Die rechte Ästhetik würde in einer Ein-Sicht in diesen Zusammenhang bestehen.
Das im Deutschen gebräuchliche Wort der „Wahr-Nehmung“, welches durch Hans Urs von Balthasar in den Diskurs eingeführt wurde, trifft diesen Zusammenhang wohl am besten. Es geht bei der Ästhetik im Sinne Hamanns und im Sinne von Balthasars nicht darum, sensuale Gehalte zu verarbeiten und diese einer subjektiven Bewertung zu unterziehen, sondern diese Gehalte als etwas Gegebenes wahr zu nehmen, das heißt die Wahrheit, die sich im Gegebenen gibt, als das anzuerkennen, was sich im Erscheinenden als das nicht Erscheinende zeigt und gibt. Diese ästhetische Logik führt im Sinne von Balthasars, aber auch im Sinne Jean-Luc Marions zu einer kenotischen Dynamik der Wahr-Nehmung. Es kann bei einem Sehen, das tatsächlich versteht, nicht darum gehen, dass sich das, was sich zeigt, als positivistischer Gehalt behauptet und dass das wahrnehmende Subjekt es dem Objekt in dem Sinne gleich tut, als dass es sich ebenfalls als Wahrnehmendes Gegenüber verabsolutiert, sondern darum, dass sich das Subjekt durch die Wahr-Nehmung des sich ihm Gebenden in eine Dynamik eingefasst findet, die es in eine Uneinholbarkeit hinein überführt, die eins ist, mit seinem eigenen Wesen. In die Terminologie der Kenotik überführt, müsste sich somit ein Bild finden lassen, „das seine eigene Sichtbarkeit los wird, um darin einen anderen Blick durchbrechen zu lassen.“ Christus wird für Marion, aber auch für von Balthasar gerade dadurch zum Bild des unsichtbaren Gottes, dass er ganz auf das eigene Ansichtigwerden verzichtet, dieses gänzlich hingibt, um nur das durchscheinen zu lassen, was das Wesen des unsichtbaren Gottes sichtbar werden lässt. Dieses Wesen könnte man aber ebenfalls in kenotischer Terminologie als Hingabe bezeichnen. Der ästhetische Nexus wäre in der Wahrnehmung der Gestalt Christi dann folgendermaßen auszuführen: Sieht ein Mensch in der Person Christi wirklich das, was in ihr zu sehen ist (den unsichtbaren Gott), wird er eingeführt in die Wahr-Nehmung der alles umfassenden und deshalb unfassbaren Größe, die seine eigene Wahrnehmungsfähigkeit übersteigt. In diesem Prozess vollzieht er selbst die Hingabe, die ihm in der Person Christi als Struktur der Wirklichkeit des unsichtbaren Gottes begegnet. In diesem Sinne vollzieht sich eine performative Einheit von Wahr-Nehmung, Hingabe und kenotischer Wirklichkeit. Eben diese Dynamik versteht Hamann unter der Praxis „Gott über alle Dinge zu fürchten und zu lieben und ihm allein zu vertrauen“.
Die Spannung, die sich abzeichnet, zieht sich somit durch die gesamte Darstellung bis hierher. Bereits das frühe alttestamentliche Bilderverbot versuchte, die eigentliche Transzendenz des Bundesgottes JHWH dadurch deutlich zu machen, dass es alle bildlichen und figürlichen Darstellungen untersagte, weil diese immer das Missverständnis der Einschränkung des Uneingeschränkten mit sich brachten. Dennoch gab es ein Bedürfnis, die Anwesenheit des Undarstellbaren darzustellen. Die anikonischen Rahmen der Bundeslade und des Tempels leisteten gerade dies: Der leere Raum, in dem tatsächlich sensual nichts zu sehen war, eröffnete den Raum für die Wahr-Nehmung der Gegenwärtigkeit des unsichtbaren Gottes. Jede Form materieller Vergegenwärtigung wäre nicht in der Lage gewesen, dies zu leisten. Hier gilt aber wiederum der ästhetische Nexus: Man sieht nur, was zu sehen ist, wenn man die rechte Ästhetik, das rechte Verständnis mitbringt. Dann ist nämlich der Raum zwischen den Flügeln der Cheruben ganz und gar nicht leer, sondern von der Präsenz Gottes erfüllt.
Die Spannung überträgt sich in Teile des Neuen Testamentes und weitet sich dahingehend, dass der leere Raum des Altares zwar immer noch die Gegenwärtigkeit des unsichtbaren und unbekannten Gottes leistet (Areopagrede), dass sich aber dieser unsichtbare Gott selber ansichtig macht in der Person Jesu Christi. Diese wird aber nur gesehen, wenn man sie nicht auf den Eindruck des sensualen Inputs reduziert, sondern in ihr gerade den Vater sieht und sie somit als das wahr-nimmt, was sie ist: Bild des unsichtbaren Gottes (Kol 1,15). Diese Wahr-Nehmung des Vaters versetzt aber den Wahr-Nehmenden in die Furcht, die Hamann beschreibt, wenn er den Prozess der Ästhetik als ganzen darin sieht, Gott zu fürchten, zu lieben und zu vertrauen. Diese Grundbewegungen beschreiben den Vorgang, in dem der wahrnehmende Mensch in den absoluten Hintergrund des Unsichtbaren vordringt, aus dem heraus alles Sichtbare erst sichtbar wird. Weil dieser Hintergrund uneinholbar ist, gerät der Mensch in Furcht, weil er uneinholbar ist, kann man sich ihm hingeben (ihm vertrauen und lieben). Dieser Hintergrund liegt aber nicht in einer Form von Hinterwelt, sondern ist konkret anwesend und wird auch konkret gesehen, wenn man im Sehen das rechte Verständnis, die rechte Ästhetik besitzt.
Die beiden Aspekte von Vertrauen und Liebe bilden hierbei eine weitere Ebene der Wahrnehmung, die ästhetisch nicht auf die Person Jesu beschränkt bleiben muss. Eher ist es so, dass Christus durch seine Durchsichtigkeit zum Vater einen Schlüssel für die Gesamtheit dessen darstellt, was Wahr-Nehmung genannt werden kann, weil die Wirklichkeit des Vaters, des unsichtbaren Gottes ja die Wirklichkeit von dem ist, worin wir uns bewegen und worin wir sind. Die Uneinholbarkeit, die in der Tiefe der Betrachtung der Person Jesu sich eröffnet ist also ungetrennt von der Uneinholbarkeit, die uns in der gesamten Schöpfung begegnet. Um dieser Tiefendimension jedoch inne zu werden, braucht es die beiden ästhetischen Bewegungen Hamanns: Vertrauen und Liebe. Auch Goethe wusste bereits, dass das, was in der Wahrnehmung auch verstanden werden soll, geliebt werden muss. Geht es in der Ästhetik also nicht allein um die Analyse der jeweiligen sensualen Prozesse und schon gar nicht um deren subjektive Bewertung, sondern darum, dass in diesen Gegebene als das wahrzunehmen, was es ist, phänomenologisch gesprochen also zu den Sachen selbst zu kommen, dann benötigt dieser Prozess einen Abzug aller Projektionen, die seitens des Subjektes auf das wahrzunehmende Objekt oktroyiert werden. Dieser Vorgang eröffnet jedoch die gesamte Weite des Begegnenden in seiner Uneinholbarkeit. Personal gewendet erscheint mir in meinem Gegenüber ein nicht einzuholendes Geheimnis, das sich mir umso mehr offenbart, je größer der Raum wird, den ich ihm in meiner Liebe gebe. Die Unverfügbarkeit des Anderen gründet primär in der mir durch ihn begegnenden Freiheit, die sich meinem Zugriff absolut entzieht, die jedoch in dem Raum meiner Liebe zunächst in die Weite findet, die sie zu dem Geheimnis macht, das mir begegnet.
Die Person Jesu weitet nun dieses Geheimnis begegnender Freiheit auf den gesamten Schöpfungshintergrund. In ihr begegnet mir nicht einfach eine Person in ihrem Freiheitsvollzug, sondern der Vater selbst und somit der Freiheitsvollzug, der die gesamte Schöpfung, in der wir sind, ins Sein gerufen hat und in diesem Sein erhält. In diesem Sinne ist Christus als Mensch Bild des unsichtbaren Gottes. Offenbart sich in ihm aber die Herrlichkeit als die Freiheit, die dem Schöpfungszusammenhang zugrunde liegt, so dehnt sich die begegnende Geheimnishaftigkeit auch auf die Schöpfung als ganze aus. Alles Sichtbare weist auf das Unsichtbare, durch das es sichtbar wird. Es geht nun aber nicht darum, dass dieses Unsichtbare nicht sichtbar werden könnte, sondern darum, dass es ja gerade durch das Sichtbare sichtbar wird als Unsichtbares. Wird das, was sich sehen lässt, im Sehen auf die rechte Weise verstanden, dann sieht man in ihm den unsichtbaren freiheitlichen Hintergrund. Dieser Hermeneutik folgend könnte sogar gesagt werden, dass das Sichtbare gerade sichtbar ist, um das Unsichtbare sichtbar zu machen. Hierbei wäre die gesamte Schöpfung als der Rahmen verstanden, der von den zwei Cheruben auf der Bundeslade gebildet wurde. Wie diese den Raum umfassten, in dem die Unsichtbarkeit Gottes sichtbar wurde, so rahmt, der dargestellten ästhetischen Logik folgend, die gesamte Schöpfung die Unsichtbarkeit des freiheitlichen Schöpfungshintergrundes ein. Diese Ästhetik, dieses verstehende Sehen, bedarf jedoch zunächst einem weltlich Sichtbaren, das tatsächlich als Sichtbares gänzlich sich selbst nichtender Verweis wird, für das Unsichtbare. In der Person Jesu zeigt sich diesbezüglich nicht ein einziges partikulares Ereignis, sondern die Wirklichkeit der gesamten Schöpfung, deren Mittelpunkt die Gestalt Christi bildet. Ihr Verweischarakter ist die Wirklichkeit der Gesamtschöpfung.
IV. Grundmuster anikonischer Darstellung in buddhistischen Kontexten
Im Folgenden soll nicht der Versuch unternommen werden, die aus dem christlichen Kontext herausgearbeiteten Argumentationsmotive direkt auf buddhistische Kontexte zu übertragen. Dieses Vorhaben würde den jeweiligen Traditionen in ihrer Einmaligkeit und Innovationskraft kaum gerecht. Dennoch soll aufgezeigt werden, dass es in zahlreichen buddhistischen Kontexten anikonische Darstellungen der Person des Buddha gab. Diese Darstellungen sollen zunächst unter Zuhilfenahme kulturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse in ihren Ansätzen verstanden werden. Dieses Verstehen bezieht auch die Begründungsstrukturen für die anikonische Darstellungsweise mit ein, soweit diese zugänglich sind. Es soll also verstanden werden, warum der Buddha anikonisch dargestellt wurde. Ist dies geleistet, kann nach den jeweils eigenen Spannungen gefragt werden, die sich in den buddhistischen Kontexten ergeben, um daraufhin auch diese Spannungen einer ästhetischen Analyse zu unterziehen. Eben diese kann dann in einem finalen Schritt ein neues Licht auf die herausgearbeiteten ästhetischen Spannungen zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit im christlichen Kontext werfen.
Dass die buddhistische Kultur keinen monolitischen Block bildet, versteht sich von selbst. Deshalb ist es zunächst ratsam, an den Anfang buddhistischer Überlieferung zurückzugehen, der nicht, wie immer noch die meisten Einführungen in den Buddhismus vermuten lassen, mit dem Leben des Buddha als historischer Person beginnt.
Die frühesten Funde buddhistischer Kultur gehen in die Zeit König Aśokas (304–232), dem König der Maurya Dynastie, zurück. Für unseren Zusammenhang relevant sind weniger die Edikte, die Aśoka in Form von Säulen- und Felsen-Edikten aufstellen ließ und die die älteste Erwähnung des Namens des Buddha enthalten, sondern die Kultstätten, die er als rituelle Verehrungsplätze des Buddha errichten ließ, die Stupas. Dies sind stilisierte Grabhügel, an denen der Ritus der Verehrung des Buddha im Status seines parinirvāṇa, also seines letzten Eingangs ins Nirvana, vollzogen wurde. Diese Grabhügel enthalten einzelne Urnen, deren Aufschriften variieren. Oftmals sind sie als Reliquien verstanden worden, was auch den Inschriften entspricht. Die Reliquienverehrung erhielt jedoch im Buddhismus eine gänzlich andere Funktion als in anderen Kontexten. Das, was man Reliquie (skt. dhātu) nannte, wurde nicht als ein Teil des Körpers einer verstorbenen, historischen Person angesehen, sondern als der lebendige Buddha selbst. Durch die Reliquien wurde der Stupa als Ganzes sogar als Person betrachtet. In den dhātus und somit im Stupa war also der Buddha anwesend in seiner Abwesenheit. Er zeigte sich und wurde verehrt, aber zunächst nicht in physischer Darstellung, sondern als der, der in seiner Abwesenheit, als der, der eingegangen ist ins parinirvāṇa, anwesend ist. Für das Thema dieses Beitrags ist dieser Zusammenhang von großer Relevanz, weil er die anikonischen Darstellungen, die sich in der vedikā, dem Umlauf um den Stupa, auf zahlreichen Reliefs findet, verständlich macht. Speziell in der frühen Phase der Stupas von Bharhut, Sāñcī, aber auch Amrāvatī, wurde der Buddha ausschließlich anikonisch dargestellt. Führt man sich die gesamte Funktion der Stupaverehrung vor Augen, ergibt sich ein Gesamtbild: Der Stupa selbst ist der Ort, an dem der Buddha im Status des gänzlichen Erwacht-Seins verehrt wird. Dieses gänzliche Erwacht-Sein ist aber nichts, das sich weltlich abbilden ließe. Der Buddha wird aber nur verehrt, weil er der gänzlich Erwachte, eben der Buddha ist. Die Reliquien in der inneren Kammer des Stupas wurden als der lebendige Buddha selbst angesehen. Die zahlreichen Inschriften machen dies unmissverständlich deutlich. Um diesen Zusammenhang besser zu verstehen seien einige Beispiele angeführt:

Abbildung I: Bharhut Ajatasattu-Stehle, ca. 125 v. Chr. (Bharhut), Stein, Indian Museum, Kolkata (Indien). Detail: Die Herabkunft des Buddha aus dem Tavatimsa-Himmel.
Das Relief der Herabkunft des Buddha aus dem Tavatimsa-Himmel (dem Himmel der 33 Götter) macht den Zusammenhang in all seiner Spannung deutlich. Das Bild (Abb. I) versucht die Szene darzustellen, in der der Buddha aus dem Tavatimsa-Himmel auf die Erde herabsteigt. Zuvor verbrachte er eine Zeit im Tavatimsa-Himmel, um seiner Mutter, die dort als Gottheit wiedergeboren wurde, seine Lehre zukommen zu lassen. Die Darstellung macht unmittelbar deutlich, dass der, der gerade aus dem Himmel auf die Erde herabsteigt, gänzlich verschieden ist von denen, die ihn sehnsüchtig erwarten. Der Buddha wird auf der Himmelsleiter dargestellt, aber nicht durch seinen physischen Körper, sondern durch zwei Füße, auf denen ein Dharma-Rad abgebildet ist. Diese Symbolik macht unmittelbar deutlich, dass es sich bei dem, der dort herabkommt, um den Buddha handelt. Der, um den es in dieser Szene primär geht, der auch in der Mitte des Bildes präsent ist, ist also nicht zu sehen. Er wird jedoch als das sichtbar, was nicht zu sehen ist. Dies wird an dieser Stelle nicht durch eine Form von Rahmung gewährleistet, wie es bei der Bundeslade oder im Jerusalemer Tempel der Fall war, sondern durch den Fußabdruck, den der Buddha hinterlässt. Das Relief steht jedoch nicht alleine. Die anikonische Darstellung des Buddha bildet die dominierende, ja in der Frühzeit des Buddhismus einzige Darstellungsweise. Abb. I steht im Stupa von Bharhut auch in einem gewissen Kontext. Es bildet die Mitte zweier weiterer anikonischer Darstellungen (Abb. II) auf der sogenannten Ajātashatru-Stehle.

Abbildung II: Bharhut Ajatasattu-Stehle, ca. 125 v. Chr. (Bharhut), Stein, Bharhut, Indian Museum, Kolkata (Indien).
Die obere Darstellung zeigt eine Form von Lehrszene, in der der Buddha die ihm folgenden Mönche unterrichtet. Er tut dies aber auf dem Stuhl des Lehrers sitzend. Die Szene ist somit klar, doch der Stuhl, auf dem der Buddha sitzt, ist scheinbar leer. Das einzige, was wiederum die Anwesenheit des Buddha unmissverständlich anzeigt, ist der Bodhi-Baum, der Baum des Erwachens. Er übernimmt die Funktion, welche auf dem Bild der Herabkunft die Füße übernommen haben. Wohl gemerkt ist auch auf dem Bild der Herabkunft der Lehrersitz unter dem Bodhi-Baum zu sehen. Die angewandte Symbolik zeigt somit nicht nur, dass der Buddha anwesend ist, sondern auch, wo er gerade ist und was er gerade tut. Die untere Darstellung ergänzt das Gesamtbild zu einem Narrativ. Dort werden eindeutig dieselben Personen gezeigt wie oben, nur diesmal in einer den Buddha verehrenden Position. Hier wird auch die Richtung der Verehrung deutlich, es ist die Richtung des ansichtig leeren Platzes des Stuhles des Lehrers. Die Präsenz des Buddha wird aber gerade durch die Bewegung der Verehrung angezeigt. Das Gesamtnarrativ der Szene wird nun auch deutlich. Zunächst ergeht die Lehre an die den Buddha folgenden Mönche (oberes Bild). Daraufhin empfängt dieselbe Lehre die verstorbene Mutter des Buddha, welche im Tavatimsa-Himmel wiedergeboren wurde (mittleres Bild). Daraufhin wird Buddha (unteres Bild) als Dank für die empfangende Lehre verehrt.
Es gäbe noch unzählige weitere Beispiele für die anikonische Darstellung des Buddha. Was die Stehle allerdings deutlich macht, ist dass es sich beim leeren Tron nicht schlicht um die Verehrung des historischen Buddha in seiner Abwesenheit nach dem Tod handeln kann, und dass solche Szenen sich so einfach abgespielt, also Mönche und Laien einen leeren Stuhl verehrt haben, auf den der durch seinen Tod abwesende Buddha imaginiert wurde. Wie genau wäre denn dann die mittlere Szene zu deuten? Wurden auch leere Leitern verehrt? Die gesamte symbolische Darstellung lässt auf etwas anderes schließen. Der Buddha selbst wurde von Anbeginn gar nicht als das wahrgenommen, was wir als schlichte historische Person verstehen. Er hat ja, so sprechen zunächst die Bilder, mit den Umstehenden, die ihn verehren, phänomenologisch, also als das, als was er erscheint, nichts zu tun. Sein Wesen scheint auf einer ganz anderen Ebene zu liegen.
Die Gründe für die anikonische Darstellung liegen somit eher in der Tatsache, dass das, was das Wesen des Buddha ausmacht, als etwas der Welt gegenüber gänzlich Transzendentes wahrgenommen wurde. Beziehen wir an dieser Stelle eine ästhetische Position ein, so wird der in den Reliefs präsentierte Sachverhalt klarer. Die Bezeichnung Buddha geht etymologisch auf die Sanskritwurzel √budh zurück, die semantisch ein schlichtes Öffnen der Augen beschreibt. Beim Öffnen der Augen geschieht jedoch, rein mechanisch betrachtet, ein Übergang von dem Status des Nicht-Sehens in den Status des Sehens. Der Name des Buddha könnte somit übersetzt werden als „Der, der sieht“. Betrachten wir vor diesem Hintergrund die anikonischen Darstellungen der Reliefs, lassen sich diese auf eine neue Art lesen. Der Buddha ist der einzige, der sieht. Schon dies ist recht eigentümlich, meinen wir doch, nicht anders als die Menschen, die auf den Reliefs dargestellt werden, dass wir Dinge sehen. Man wacht morgens auf und nimmt die Repräsentation der Welt visuell wahr. Das nennen wir Sehen. Doch der einzige, der sieht, der Buddha, ist auf den Reliefs der einzige, der auf dieser Ebene nicht zu sehen ist. Das, worin uns die Reliefs didaktisch unterrichten wollen, ist dass das, was wir Sehen nennen, die Wahrnehmung auch der umstehenden Figuren des Buddha, ein Nicht-Sehen ist. Erst wenn wir das sehen, was auf dem Relief das einzige ist, das als das Nicht-zu-Sehende zu sehen ist, sehen wir wirklich.
Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang, wenn wir Reliefs heranziehen, die den Betrachter explizit mit in die Situation einbeziehen.

Abbildung III: Trommelplatte (mit Geburt des Buddha, anikonisch), 1. Jhd. n. Chr. (Amarāvati) Kalkstein, 157,50×96,25×14,00cm, British Museum, London.
Die in Abb. III dargestellte Geburt des Buddha (rechts unten) zeigt, wie Buddhas Mutter Maya ihren Sohn aus ihrer Seite heraus zur Welt bringt. Dieser ist bereits zur Welt gebracht und befindet sich auf dem dargestellten Hocker. In den Kreis der umstehenden Personen wird der Betrachter unmittelbar mit eingebunden, was die Perspektive deutlich macht. Dies zeigt, dass der Sinn dieser Darstellungen tatsächlich in einer Form von Vergegenwärtigung liegt. Allerdings nicht der Geburt einer rein historischen Person, sondern der Geburt dessen, der sieht und mit dem das Sehen in die Welt kommt. In gewisser Weise scheint der Betrachter des Reliefs zu lernen, wie all das, was er scheinbar jeden Tag sieht, zu betrachten ist, nämlich als Nicht-Sehen. Das, worum es wirklich geht, die Mitte auch dieser dargestellten Szene, ist nicht auf die Weise zu sehen, wie man das Sehen bisher versteht.
Bezüglich einer Ästhetik, also der Frage, wie das Sehen des Menschen zu verstehen ist, müsste nun weiter verstanden werden, wie sich die Entwicklung von der anikonischen zur ikonischen Darstellung des Buddha, die im Westen alleinig bekannt zu sein scheint, vollzogen hat. Hier ist sich zumindest das kulturwissenschaftliche Feld weitreichend einig. Die Entwicklung vollzog sich nicht rein innerbuddhistisch. Die buddhistische Kultur war zu Anfang Teil eines allgemeinen Umfeldes, welches sich über Indien bis Pakistan in den heutigen Iran und Irak erstreckte. Zur selben Zeit wie der buddhistische Kulturzweig entwickelten sich auch hinduistische und jainistische Kulturen von einer anikonischen in eine ikonische Phase. Gründe hierfür liegen wohl primär in einer Stärkung der Laienbewegung, die sich eher auf die Verehrung anthropomorpher Darstellungen richtete, aber auch in der Bhakti-Bewegung. Diese brachte als konstitutives Moment vor allem die Hingabe zu einer personalen Gottheit mit sich. Um diese liturgisch hinreichend abzubilden, war es schlicht notwendig, personalisierte Darstellungen zu entwickeln, wie es dann auch im Hinduismus, Jainismus und Buddhismus zur gleichen Zeit geschah. Im Buddhismus lagen für diese Darstellungen allerdings bereits Schriftzeugnisse vor. So vor allem die an zahlreichen Stellen in den Sutren aufgeführten 32 physischen Merkmale des Buddha (skt. mahāpuruṣa lakṣaṇa). Diese weisen den Buddha als einen überaus perfekten Menschen (skt. mahāpuruṣa) aus, der dementsprechend auch einen überaus perfekten Körper besitzt. So wird er meist mit breiten, oft muskulösen Schultern dargestellt, die in eine schmale Taille überleiten. Die ersten figurativen Darstellungen des Gesamtkorpus finden sich zwischen dem 1. und 2. Jhd. n. Chr. in etwa gleichzeitig in Mathurā und Gandhāra. Sie folgen in weiten Teilen den schriftlichen Überlieferungen der 32 Merkmale und stellen den Buddha auch als physisch allem überlegene Figur dar, die über eine überdurchschnittliche Größe und Schönheit verfügt. Als ein wunderbares Beispiel für die Verarbeitung der Merkmale in figurativer Darstellung kann der stehende Buddha von Gandhāra herangezogen werden (Abb. IV).

Abbildung IV: Stehender Buddha von Gandhāra, 2. Jhd. n. Chr. (Gandhāra), Kalkstein, Tokyo National Mu-seum, Tokyo.
Er zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Schönheit aus, die ihn nach den überlieferten Merkmalen zeichnet. Spannend ist, dass diese Darstellung das Produkt einer Begegnung zwischen indischer Textüberlieferung und griechischer Handwerkskunst und Kultur ist, die sich im Gandhāra des 2. Jhd. immer mehr Raum verschafft hat. Mit der Entwicklung in Gandhāra und Mathurā beginnt sich die ikonische Darstellung im gesamten buddhistischen Kulturraum durchzusetzen. Dies allerdings, wiederum ähnlich wie im Christentum, nicht ohne Widerspruch. Dieser gewann an Raum in einem Einflussfeld, dass vor allem durch die Literatur der Prajñāpāramitā geprägt war, einer philosophischen Richtung, die ab dem 1. Jhd. enormen Einfluss auf die buddhistische Kultur ausübte und speziell die mahayanistischen Schulen primär prägte. In einem prominenten Sutra dieser Richtung, dem Diamantsutra, heißt es:
“‘Subhūti, what do you say? Can one discern the Tathāgata by means of his bodily characteristics?’ ‘No, World-honored One. One cannot see the Tathāgata by means of bodily characteristics. Why not? The bodily characteristics taught by the Tathāgata are actually not bodily characteristics.’ The Buddha said to Subhūti: ‘All things that have characteristics are false and ephemeral. If you see all characteristics to be non-characteristics, then you see the Tathāgata.’”
Übersetzt man den Text an dieser Stelle etwas genauer, dann stellt der Buddha die Frage an Subhuti, ob es möglich ist, den Buddha zu sehen (見), wenn man das sieht, was körperlich zu sehen (身相) ist. Am Ende des Kapitels geht es aber gerade darum, dass man den Tathāgata (den So-Gekommenen, ein anderer Name für den Buddha) sieht, wenn man alles, was physisch sich zeigt, als das sieht, was sich nicht zeigt. Erinnern wir uns an die Analyse des Namens Buddha und die Stimmigkeit der ersten anikonischen Darstellungen (s. o.) dann zeigte sich dort bereits dieselbe Struktur.
Die Logik, die das Diamantsutra ansetzt, ist im gesamten buddhistischen Kanon der Prajñāpāramitā-Literatur bekannt und leitend. Man könnte sie allgemein folgendermaßen formalisieren: a=⌐a => a=a. Also nur wenn man sieht, dass alles, was zu sehen ist (a), tatsächlich nicht zu sehen ist (⌐a), sieht man, was wirklich zu sehen ist (a=a). Das Diamant-Sutra geht diese Logik an zahlreichen, oft lebenspraktischen Beispielen durch, was hier nicht weiter ausgeführt werden kann. Wichtig ist aber die sich bereits andeutende ästhetische Konsequenz: Das Sehen dessen, was sich visuell zeigt, ist ein Nicht-Sehen. Sieht man, dass dieses Sehen ein Nicht-Sehen ist, beginnt man zu sehen. Vollendet man diesen Prozess der Einsicht, wird man ein Sehender, ein Buddha.
Der weitreichende Einfluss, den die Prajñāpāramitā-Literatur vor allem in China erhielt, führte zu einem abgeschwächten Ikonoklasmus im buddhistischen Kontext dieses Kulturraumes. Es wurden zwar keine Bildnisse zerstört, jedoch wurde Abstand genommen von bildlichen Darstellungen, da die Schriften selbst davon abrieten, sich ihnen zuzuwenden. Die vollzogene Praxis der Prajñāpāramitā besteht primär darin, einzusehen, dass das einzig Wirkliche, „ohne Namen und ohne Zusehendes“ (無名無相) ist. Dem, was ohne Namen und ohne Form ist, eine Form zu geben und dieser dann Verehrung zukommen zu lassen, widerspricht der Praxis der Prajñāpāramitā.
Eines der zentralsten Prajñāpāramitā-Sutren, das Herz Sutra, etabliert jedoch an der wahrscheinlich in der westlichen Buddhismus-Rezeption prominentesten Stelle, eine andere Sichtweise, die nochmals die ästhetische Analyse erweitert. So heißt es im Sutra:
Form ist gleich der Leerheit 色不異空
Leerheit gleich der Form 空不異色
Um die Wichtigkeit dieser Stelle herauszustellen, fährt das Sutra fort:
Form ist wirklich diese Leere 色即是空
Diese Leere ist wirklich diese Form 空即是色
Diese Aussage kann wiederum ästhetisch in eine Richtung interpretiert werden, die uns bereits bei den frühen anikonischen Darstellungen begegnet ist. Der Begriff der Leerheit spielt hierbei eine große Rolle. Ohne diese hier hinreichend einholen zu können, sei die Semantik dahingehend zusammengefasst, dass dieser Begriff primär einen apophatischen Charakter besitzt, der in den meisten Schulen radikal ausformuliert wird. Leerheit ist gerade das, was „ohne Namen und ohne Zusehendes“ ist. Das, was tatsächlich ist, ist jenseits all dessen, was der Mensch wahrnehmen könnte. Die Welt der Phänomene wird schlicht vom Bewusstsein des Menschen konstruiert, entspricht aber nicht dem, was wirklich ist. Das, was wirklich ist, ist jenseits aller Konstruktionen, also jenseits all dessen, was man meint zu sehen.
Oft ist dieser Aspekt auch unter dem Begriff der Anātman-Lehre, die Lehre des Nicht-Selbst, bekannt. Diese macht nochmals gesondert die eigentliche Sinnhaftigkeit der anikonischen Darstellung zugänglich. Ihre Grundaussage besteht darin, dass es kein beständiges Selbst in irgendeinem Phänomen gibt, somit auch nicht in der Person eines Menschen. Das, was wir unter Sehen verstehen, widerspricht jedoch diametral dieser Einsicht, weil unser Sehen verobjektivierend ist. Der Buddha als der, der diesen Zusammenhang sieht, ist auf den Darstellungen nicht zu sehen. Dieses Nicht-Sehen eröffnet aber gerade eine Einsicht in die Leerheit der Person, in ihre Nicht-Selbst-Haftigkeit. Das heißt jedoch nicht, dass in der Person nichts da ist. Das, was da ist, ist jedoch jenseits von Sein und Nichtsein und somit jenseits jeglicher Kategorie des dichotomen Bewusstseinsvollzugs. Es geht ja gerade darum, zu lernen, dass das, was man gemeinhin Sehen nennt, ein Nicht-Sehen ist. Das, was aber die tatsächliche Wirklichkeit bildet, ist leer in dem Sinne, dass es keinerlei Kategorien im menschlichen Bewusstsein gibt, die dieser Wirklichkeit in ihrer Auslegung gerecht werden.
Ein weiterer Aspekt, der hier nur angerissen werden kann, der aber für das Verständnis von entscheidender Bedeutung ist, ist die buddhistische Praxis des Nicht-Zweiens. Allgemein wird diese aus westlicher Perspektive oft schlicht als Meditation bezeichnet. Es geht buddhistischen Mönchen in den meisten Schulen jedoch nicht darum, sich selbst als Mensch in die Wirklichkeit zu vertiefen, sondern darum, zu Nicht-Zweien. Das heißt, wenn all das Sehen des Alltagsbewusstseins ein Nichtsehen ist, dann liegt der Ursprung des Nichtsehens in der Zweiung, darin, dass jede Form von Bewusstsein immer intentional ist, das heißt immer Bewusstsein von etwas. Das Sehen, zu dem die frühen Reliefs und die Prajñāpāramitā-Literatur anleiten wollen, ist jedoch ein Sehen, dass diese Zweiheit nicht kennt, weil es jegliche Zweiheit überwunden hat.
Betrachten wir nun den Gedanken der Transzendenz, der bei der Analyse früher jüdischer und christlicher Anikonik leitend war, und der drohte, in der Anfangsanalyse auch auf die buddhistischen Traditionen projiziert zu werden, bringt der Gedanke der Nicht-Zweiheit eine neue, ästhetische Perspektive mit sich, die im Herz-Sutra deutlich wird und von weitreichender Relevanz ist. Es kann nämlich nicht so sein, dass der Buddha, der auf den Reliefs nicht zu sehen ist, einfach in einer Jenseitswelt lebt. Er ist ja tatsächlich da. Er geht tatsächlich die Leiter herunter. Die Unbegreiflichkeit dessen, was den Erwachten ausmacht und was in seiner Unsichtbarkeit zum Ausdruck kommt, ist jedoch, durch den Gedanken des Nicht-Zweiens, nicht verschieden von der eigentlichen Unbegreiflichkeit all jener, die um ihn herumstehen. Die Form, die in ihnen Ausdruck findet, ist nichts anderes als die Leere, die sich im Buddha zeigt. Auch ihre Form ist gleich der Leerheit, die sich ihnen in der Person des Buddha präsentiert.
Doch gibt es auch Darstellungen, die diesen Zusammenhang nahezu unmissverständlich klar machen? Im Stupa von Amrāvatī wurden ca. im 2. Jhd. einige Reliefs angefertigt, die zumindest auf diesen Zusammenhang deuten (Abb. V und VI). Der Satz des Herz Sutra scheint in diesen Abbildungen zumindest von seiner Bedeutung her dargestellt: Die Leere als die absolute Unbegreiflichkeit des Erwachten ist die Form, die er als Śākyamuni-Buddha angenommen hat. Der Logik der Prajñāpāramitā folgend kann man somit sagen, dass sobald der Sinn der anikonischen Darstellung verstanden ist, der Buddha Form annimmt.

Abbildung V: Trommelplatte (mit Buddha, anikonisch), ca. 2. Jhd. n. Chr. (Amrāvatī), Kalkstein, Government Museum, Chennai (Indien).

Abbildung VI: Trommelplatte (mit Buddha, ikonisch), ca. 2. Jhd. n. Chr. (Amrāvatī), Kalkstein, 136,60×86,20×16,00cm, British Museum, London.
Das obere Relief stellt noch den Buddha traditionell anikonisch mit dem Symbol des Dharma-Rades dar. Die untere zeigt eine figürlich menschliche Darstellung in der der Buddha auf einer Sänfte stehend aus dem Stupa getragen wird. Es handelt sich eindeutig um ein und denselben Stupa. Auch wenn der Zusammenhang mit der Prajñāpāramitā-Literatur hier nicht nachweislich ist, kann man doch vermuten, dass zumindest die Grunderfahrung, aus der diese Form der Literatur zunächst erwachsen ist, bereits in den Reliefs von Amrāvatī gegenwärtig war.
Die oben ausgeführte Logik des soku-hi, die aus der Prajñāpāramitā deduziert wurde, lässt sich hier ebenfalls in bildhafter Darstellung wiederfinden. Nur wenn man sieht, dass der figürliche Buddha der unteren Darstellung als das zu sehen ist (a), was nicht zu sehen ist (obere Darstellung/⌐a), dann sieht man den Buddha als das, was er ist (a=a). Zu rechnen ist jedoch damit, dass diese Logik nicht allein Amrāvatī zugrunde liegt, und auch nicht auf die Lektüre der Prajñāpāramitā zu beschränken ist. Eher ist es so, dass überall, wo der Buddha als Figur, als Mensch dargestellt wird, er als das zu sehen ist, was eins ist mit der Unfassbarkeit, welche eben dann zu sehen ist, wenn man die Augen geöffnet hat, wie der Buddha. Die Form des Buddha (unten) ist nicht verschieden von seiner Leerheit (oben). Dies scheinen uns die Reliefs von Bharhut, Sāñcī und Amrāvatī in ihren zahlreichen Darstellungen fast mit didaktischer Methodik vermitteln zu wollen.
V. Ästhetische Zusammenschau
Betrachtet man die semantischen Begründungsmuster, die den jeweiligen anikonischen Darstellung zugrunde liegen, so zeigen sich zunächst tatsächlich zahlreiche Ähnlichkeiten zwischen jüdisch-christlichen Bezugssystemen und frühen buddhistischen Strukturen. Dabei liegt eine der zentralen Intentionen früher anikonischer Darstellungen auf beiden Seiten in der eigentlichen Transzendenz dessen, was sie versuchen abzubilden. Der Bundesgott JHWH ist weder ein Ereignis noch ein materielles Objekt des weltlichen Zusammenhangs. Ihn figürlich herzustellen, würde somit immer das Uneinschränkbare seines Wesens, das ja gerade dargestellt werden soll, einschränken. Eine figürliche Darstellung wäre somit gerade keine Darstellung dessen, was gemeint ist.
Ähnliches gilt für die frühen buddhistischen Bezugssysteme. Auch hier ist das Wesen des Erwachten weder ein Welt-Ding noch ein Ereignis der Welt. Die Darstellungen zeigen auch eindeutig, dass es sich beim Buddha um etwas ganz anderes handelt als um eine historische Person. So hält auch Claudia Wenzel fest:
“[I]t might be said in conclusion that the early ‘aniconic’ phase of Indian Buddhism seems to share with Christianity the notion that the highest truth – Buddhahood or enlightenment, and the godhead respectively – was ultimately invisible.”
Das Problem, um das es an dieser Stelle also in beiden Bezugssystemen geht, ist das von Wirklichkeit und Darstellung: Wenn die Wirklichkeit, die darzustellen ist, jenseits allen Darstellbaren liegt, so kann sie nur dargestellt werden als das, was in der Darstellung jede Darstellung transzendiert. Beide Kulturkontexte haben auf ihre Weise versucht, dieses Problem künstlerisch zu lösen. Beiden gemeinsam ist ebenfalls, dass sie einen Rahmen geschaffen haben, der eindeutig die Anwesenheit dessen deutlich machte, was sich nicht darstellen lässt. Die beiden Cheruben machten unmissverständlich klar, dass in dem Raum, den sie einfassten, die Gegenwart dessen geschah, der sich nicht darstellen ließ. Auf diese Weise wurde aber der leere Raum zwischen den Cheruben gerade zur Darstellung des Nichtdarstellbaren. Die zahlreichen frühen anikonischen Darstellungen des Erwachten weisen eine ähnliche Struktur auf. Auch in ihnen wird die Präsenz des Buddha unmissverständlich deutlich. Gerade diese Deutlichkeit lässt aber sein Wesen als das, was sich nicht gestalthaft darstellen lässt, deutlich werden.
Ohne in tiefgreifende Projektionen zu verfallen, sei noch eine weitere bemerkenswerte Ähnlichkeit festgehalten: In beiden Kulturen schien zu einer ähnlichen Zeit das Bedürfnis nach figürlichen Darstellungen aufgekommen zu sein. Im christlichen Kontext kann hier eher davon ausgegangen werden, dass das Bedürfnis der Darstellung schon immer bestand, mit der Ausdifferenzierung einer Offenbarungstheologie um die Person Christi jedoch eine andere Dynamik annahm. Denn nach paulinischer Theologie ist Christus ja gerade das Bild des unsichtbaren Gottes. Die Diskursebene vertieft sich weiter, wenn man den Streit zwischen Ikonodulen und Ikonoklasten einbezieht, der eine ähnliche Stoßrichtung annimmt, wie der eigentliche Streit zwischen bildlicher und bildloser Darstellung des Bundesgottes JHWH. Wiederum geht es um die Frage nach dem Verhältnis von Wirklichkeit und Bild. War bezüglich des Bundesgottes JHWH und dem Zusammenhang des zweiten Gebotes unmissverständlich klar, dass sich Bildnisse im jüdischen Kontext verbieten, änderte sich dies im Christentum dahingehend, dass sich Gott in Christus selbst dazu entschieden hat, sich ansichtig zu machen. Die Frage war dann, ob und wie es dem Menschen möglich war, diese Ansichtigkeit in Christus erneut herzustellen, also künstlerisch abzubilden. Im Christentum wird die leitende Legende des Evangelisten Lukas ausformuliert, um im Verlauf des 8. Jhd. der ikonoklastischen Bewegung in Byzanz entgegenzuwirken. So soll Lukas die erste wahrhaftige historische Ikone angefertigt haben, auf der dann alle weiteren beruhten. Diese wurden jedoch keinesfalls als schlichte Abbildungen der historischen Persönlichkeit Jesu verstanden, sondern als seine lebendige Gegenwart.
Auch dieser Zusammenhang zeichnet sich recht ähnlich im buddhistischen Kontext nach und wird in der Legende des Königs Udyāna ausformuliert. König Udyāna war betrübt über die Abwesenheit des Buddha, als dieser in den Himmel hinauffuhr, um seiner Mutter die Lehre zukommen zu lassen. Daraufhin schuf er ein Abbild des Buddha aus Sandelholz. Nachdem der Buddha aus dem Himmel wieder auf die Erde herabgestiegen war, würdigte er Udyānas Bildnis und formulierte die Verdienste, die jenem Menschen zukommen, der ein Bildnis des Buddhas anfertigt. Die Legende des König Udyāna steht nicht allein. Neben ihr gab es zahlreiche weitere Legenden, die von der Anfertigung von Bildnissen berichteten. Ihre Funktion ist dabei immer die gleiche: Es muss eine innere Sinnhaftigkeit für die anikonische Tradition gegeben haben, der man entgegenwirken musste. So macht es Sinn, dass die Legende Udyānas gerade in Gandhāra abgebildet wird, um die Transformation zur ikonischen Tradition zu moderieren.
Es bleibt jedoch festzuhalten, dass sowohl in christlichen als auch in buddhistischen Kontexten immer vor einer Verwechselung des Abbildes mit seinem Ursprung gewarnt wurde. Im buddhistischen Kontext ist es die Literatur der Prajñāpāramitā, die diese Gefahr deutlich ausdrückte und letztlich wiederum zu einem Ikonoklasmus führte. Was sie jedoch deutlich macht, ist dass der Buddha in all seinen Darstellungen das bleibt, was nicht darstellbar ist. Im Mahayana Sutra über die Verdienste der Bildherstellung wird die Legende des Udyāna im Zuge der Entwicklung auch weitergeführt. Udyāna, so heißt es, bereute angesichts der uneinholbaren Wirklichkeit des Buddha, ein Bildnis erschaffen zu haben. Der Buddha jedoch beschwichtigte ihn, indem er ihm versicherte, dass er, obwohl das Bildnis seiner Wirklichkeit nicht gerecht wird, unzähligen Wesen den Weg zum wahren Vertrauen in den Buddha gebahnt habe. Die Bildnisse galten in der weiteren Tradition des Mahayana somit als Geschickte Mittel (skt. upāya), also als Weisen, die der Buddha selbst wählte, um sich ansichtig und seine Lehre zugänglich zu machen. Dies führt wiederum zu einer gewissen Ästhetik, also einer rechten Weise, mit der die figürliche Darstellung des Buddha angeschaut werden muss, wenn man sie verstehen will.
Bei aller Diversität der buddhistischen Kultur, die bereits im 2 Jhd. n. Chr. vorlag und sich vor allem durch die Übersetzung nach China verstärkte, scheint das Grundproblem ziemlich einheitlich zu sein: Wie lässt sich das abbilden, was jenseits alles Bildlichen liegt? Beziehen wir an dieser Stelle das oben bereits erwähnte Herzsutra und den Zentralsatz: „Form ist gleich der Leere“ ein, so erweitert sich der Zusammenhang folgendermaßen: So wie der Buddha in seiner Form lediglich die Formlosigkeit der Leerheit der letzten Wirklichkeit darstellt, so zeigt sich diese Formlosigkeit in jeder erscheinenden Form. Das Relief von Amrāvatī (Abb. V) liefert somit eine ästhetische Auslegung der Gesamtwirklichkeit. Wenden wir hier den Begriff der Ästhetik als ein gewisses Verstehen an (s. o.), dann wäre dieses dann gegeben, wenn man beim Betrachten der figürlichen Darstellung des Buddha die Leerheit sieht. Wer in der Betrachtung eine historische Persönlichkeit vor Augen hat, verfügt nicht über das Verständnis, man könnte sagen nicht über die Ästhetik, die nötig wäre, das zu sehen, was wirklich zu sehen ist. Wichtig ist, dass der beschriebene Zusammenhang nicht alleine für den Buddha gilt. Dieser bildet lediglich die Antwort auf die Frage, was es überhaupt heißen könnte, zu sehen. Es hieße, nochmals abschließen, zu sehen, dass das, was wir allgemein Sehen nennen, ein Nichtsehen ist. Dies erweitert den Modus, in den uns die Reliefs in der Auslegung der Prajñāpāramitā einführen, auf die allgemeine Weltwahrnehmung. Auch ein Baum wird nur dann wirklich gesehen, wenn man in ihm die Leerheit sieht und nicht den Baum als positiviertes Objekt.
Was sieht ein Mensch nun, wenn er Christus sieht? Nach Joh 14,19 den Vater. Das heißt aber, dass jemand, der wiederum rein den Zimmermannssohn Jeshua ben Josef sieht, nicht das ästhetische Vermögen besitzt, zu verstehen, was er sieht. Aber wenn er in Jesus den Vater sieht, dann begegnet ihm das absolut Unbegrenzte in der Gestalt eines begrenzten Menschen. Wenn wir verstehen, dass der buddhistische Begriff der Leerheit nicht einfach eine Negation darstellt, sondern auf etwas absolut Transzendentes, Uneinholbares verweist, dann wäre der Satz des Herz-Sutra „Form ist gleich dieser Leere“ in gewisser Weise, wenn auch nur unter Vorbehalt und mit einem gewissen Maß christlicher Aneignung, auf die Person Jesu anwendbar. Denn in dieser Form Jesu, in diesem konkreten Jeshua ben Josef, begegnet der absolut uneinholbare Schöpfungshintergrund des Vaters selbst. Wer das sieht, schaut Christus und besitzt das rechte ästhetische Vermögen, das rechte Verstehen, das weit über die schlichte Verarbeitung des sensualen Inputs hinausweist. Die buddhistische Darstellung kann uns an dieser Stelle eine Dimension erschließen, die dem Christentum zumindest nicht ganz fremd ist. Denn auch die Hermeneutik der Öffnung des Geschehens der Schau des Vaters auf die gesamte Schöpfung ist christlicherseits durchaus möglich. Wenn die Hingabegestalt, die in Christus begegnet, die Gestalt des Vaters ist, dann ist es die Hingabe der Liebe, die der gesamten Schöpfung zugrunde liegt. Ist dem so, dann wäre die rechte Ästhetik, die auch auf alle begegnenden Schöpfungswerke anzuwenden wäre, jene, die den Vater als den liebenden freiheitlichen Schöpfungshintergrund sieht. Dieses Sehen wäre aber ein Verstehen, dass jeglichen direktkategorialen Zugriff übersteigt, weil in ihm jegliche phänomenale Positivierung des menschlichen Bewusstseins aufgebrochen werden müsste. Dies hieße nach Hamann „Gott über alle Dinge zu fürchten und zu lieben und ihm allein zu vertrauen“ und wäre in diesem Sinne auch die älteste Ästhetik.
Die Liebesdimension des freiheitlichen Schöpfungshintergrundes ist aber kenotisch strukturiert. In Christus zeigt sich der Vater ja nicht anders, als er tatsächlich ist. Somit zeigt sich insbesondere in der Kreuzesgestalt die Hingabegestalt des Vaters als die kenotische Wirklichkeit, die allem zugrunde liegt. Übersetzt man an dieser Stelle Kenosis korrekt mit dem Begriff der Entleerung, weisen die beiden Konzepte der Kenosis und der buddhistischen Leerheit zwar immer noch in verschiedenen Richtungen, gleichzeitig jedoch auf eine enorme Resonanz. Verstehen wir Kenosis nicht einfach als einen Tätigkeitsbegriff, sondern auch als eine Chiffre für den Akt, der die Schöpfung ins Sein gerufen und in diese Schöpfung ebenfalls den Sohn gesandt hat, um die Schöpfung von innen her zu erlösen[75], so bildet diese Dimension den inneren Kern der Schöpfung selbst, der gleichzeitig für die menschliche Vernunft uneinholbar ist. Er erhält somit notwendig eine gewisse apophatische Dimension, die uns auch beim Begriff der Leerheit im buddhistischen Kontext entgegentritt.
Auf diese Weise versuchen alle Formen der anikonischen Darstellung, dem Betrachter ein neues Sehen, eine neue Ästhetik zu vermitteln. In diesem müsste sich in gewisser Weise auch die Frage der Transzendenz auflösen. Buddhistisch betrachtet schlicht deshalb, weil das Ansetzen einer transzendenten Ebene, in der der Buddha tatsächlich positivistisch sichtbar wäre, allem wiederspräche, was uns die Reliefs und auch die Prajñāpāramitā zu vermitteln versucht. Der Buddha ist ja in dem Relief tatsächlich anwesend. Es gibt dort keine Hinterwelt. Der Transzendenzbegriff wäre ein ästhetischer. Wir besitzen schlicht nicht das Verstehen in unserem Sehen, das nötig wäre, um zu Sehen, was sich im Buddha tatsächlich ansichtig macht.
Diese Hermeneutik eröffnet auch einen zu vielen modernen Zugängen alternativen Zugang zum Christusgeschehen. In Christus zeigt sich wirklich nicht schlicht eine historische Gestalt, sondern der Vater selbst. Damit eröffnet sich in Christus jedoch der Schlüssel für das Verständnis des gesamten Schöpfungszusammenhang und damit auch für eine Ästhetik, die diesen auf die rechte Weise wahr-nimmt. In dieser Wahr-Nehmung wäre Christus wiederum nach Hamann „Hauptschlüssel aller unserer Erkenntnis“. Er wäre dies, weil sich in ihm das, was sich eigentlich vernunftgemäß unvermittelbar gegenübersteht, Gott und Mensch, als eine unverbrüchliche Einheit präsentiert. Die Form, die sich in Jesus zu sehen gibt, ist gleich der kenotischen Leere des Vaters, die sein Liebeswesen ausmacht, das die Schöpfung ins Sein gerufen hat. Somit lässt sich aber diese Leerheit in jeder begegnenden Form erkennen, wenn sich die Wahr-Nehmung des Menschen in die Ästhetik weiten lässt, die uns die Gestalt Christi vermitteln möchte und die uns diese semantischen Bezüge der anikonischen Darstellung des Buddha zu erschließen geholfen haben.